Termine und Kosten der hier vorgestellten Kurse entnehmen Sie bitte dem Programm 2025/26 und den Zusatzangeboten 2026
503 K Wie und warum sich das Deutsche immer schneller wandelt - Zusatzangebot Frühjahr 2026
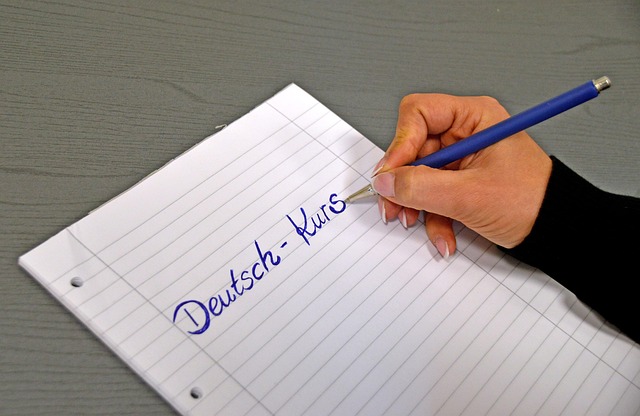
Wer beruflich mit der deutschen Sprache zu tun hat, sei es als Journalist, als Texte-Verfasser, als Übersetzer oder auch als Lehrer (bzw. *in), kann ein Lied davon singen, wie rasch neue Wörter aufkommen, alltäglich werden – oder auch ebenso rasch wieder verschwinden.
Modewörter eben. Hat’s schon immer gegeben. Neu und in unserer liberalen Gesellschaft heftig umstritten sind jedoch
- einerseits die Lockerung grammatischer und orthografischer Regeln („Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“) und
- andererseits die Tendenz, neue sprachliche Normen aus politisch-moralischen Gründen aufzustellen und vorzuschreiben.
Um beides soll es in diesem Kurs gehen.
Bild von Katja Fissel auf Pixabay
502 Berühmte Autoren VIII
Starke Stimmen, starke Frauen
Neuübersetzungen und Neuerscheinigungen aus Italien

Im Herbst 2024 war Italien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse und bot eine Fülle an aktuellen Büchern auf. Auffallend war eine starke Präsenz von Autorinnen, die entweder erstmals oder wieder neu übersetzt worden waren, wie zum Beispiel Elsa Morantes Nachkriegsroman La Storia.
Die Autorinnen beschreiben zerrüttete Familienverhältnisse, mühsame Wege zur Integration und Selbstbehauptung, sie thematisieren eine Gesellschaft, in der man als junger Mensch an allen Ecken und Enden ausgebremst wird und nicht vorankommt. Sie erzählen auch von behüteter Kindheit und tauchen ein in die Geschichte ihres Landes.
Es sind starke Stimmen von starken Frauen und spannende Bücher, die im Verlauf des Kurses vorgestellt werden und hoffentlich auch Lust aufs Lesen machen. Dies ist allerdings nicht Voraussetzung zur Teilnahme am Kurs.
Foto: Orna auf Pixabay
504 K Spracherwerb und Mehrsprachigkeit

Eine Sprache haben wir alle erworben, die erste meist mühelos in der Kindheit. Später neue Sprachen zu lernen, ist meist schwieriger. Ansichten und Meinungen zur Sprache und zum Spracherwerb haben wir auch fast alle, manche gut fundiert andere weniger. In der Wissenschaft nehmen sich viele Disziplinen, zunehmend auch die Psychologie und die Medizin, der Sprache an. Dies hat zu zahlreichen neuen Erkenntnissen geführt, die in der Öffentlichkeit zum Teil noch nicht hinreichend bekannt sind.
Der Kurs verfolgt das Ziel, einige dieser neuen Entdeckungen zum Spracherwerb und zur Mehrsprachigkeit den Teilnehmern nahe zu bringen und sie mit Aussagen zur Sprache zu konfrontieren, die in der Presse zu finden sind:
"Je früher man eine Sprache lernt, desto besser." Wirklich?
Es heißt, dass Mehrsprachigkeit die Entwicklung des Kindes fördert und die kognitiven Fähigkeiten im Alter wachhält. Stimmt das?
"Sprachen sind unendlich produktiv und flexibel." Wirklich?
Wie kann man sich digitale Werkzeuge zunutze machen für das Erlernen einer Sprache und den Umgang mit einer fremden Sprache?
Auf diese Fragen wird versucht, Antworten zu geben, mit anschaulichen Beispielen und interessanten neuen Forschungsergebnissen.
Foto: Oli Lynch auf Pixabay
505 Literarische Entdeckungen IV
Liebesgeschichten im 21. Jahrhundert - Gibt es die überhaupt noch?

Das Geschäft mit den New Romance Romanen blüht. Allein EL James ‘Fifty Shades of Grey‘ Romane von 2011/12 wurden über 150 Millionen Mal verkauft – sie sind weit vor Janes Austens ‘Stolz und Vorurteil‘ die meistverkauften Liebesromane aller Zeiten.
Bedeutet das, dass klassische Liebesgeschichten wie Shakespeares Romeo und Julia, Goethes Leiden des jungen Werther, Tolstois Anna Karenina, Highsmiths Carol oder der Mythos von Tristan und Isolde sich nur noch in New Romance Romanen entdecken lassen?
Sind sie außerhalb dieses Genres nicht mehr zeitgemäß?
Ist unsere Zeit zu nüchtern, zu sehr dem Visuellen verpflichtet, um sich literarisch in die Tiefen und Untiefen der Liebe zu wagen?
Keine Bange: auch im 21. Jahrhundert sind Schriftsteller und Schriftstellerinnen unabhängig von irgendeinem Genre dem Thema Liebe auf der Spur. Deshalb werden wir im Seminar einen Bogen um die New Romance Romane machen und sechs andere aktuelle belletristische Liebes-Perlen gemeinsam lesen und diskutieren.
In jeder der acht Kurseinheiten wird ein literarisches Werk besprochen. Die Voraussetzung für eine Teilnahme besteht nur darin, das Werk vorher zu lesen und Interesse an Gesprächen über die Welt der Literatur mitzubringen.
Foto: Foto von Devanath auf Pixnio
Anmeldung
506 Kreatives Schreiben
Ausprobieren und Experimentieren mit Sprache. Biografisches Schreiben

Im Zentrum des Kurses steht das spielerische Ausprobieren und Experimentieren mit Sprache durch kreative Schreibübungen. Finden Sie heraus, was Ihnen Spaß macht.
In verschiedenen Schreibanlässen werden eventuell vorhandene Schreibhemmungen abgebaut; es entstehen Kurzinhalte, die vorgelesen, verglichen und gewürdigt werden.
Darüber hinaus bietet der Kurs die Möglichkeit, sich schreibend mit der eigenen Lebensgeschichte auseinanderzusetzen (Biografisches Schreiben). Anhand von Bildern oder Erinnerungsstücken werden persönliche Erlebnisse wieder lebendig und von den Teilnehmern schreibend reflektiert. Es sind keine Schreiberfahrungen erforderlich.
Foto: Pexels auf Pixabay

